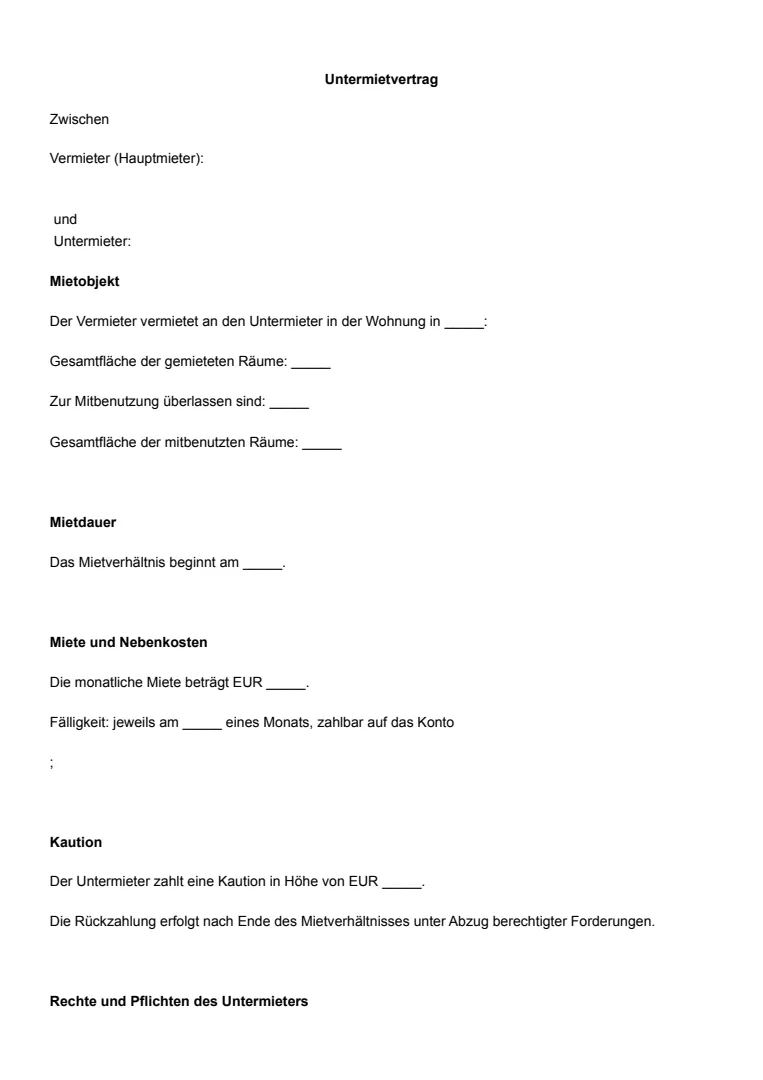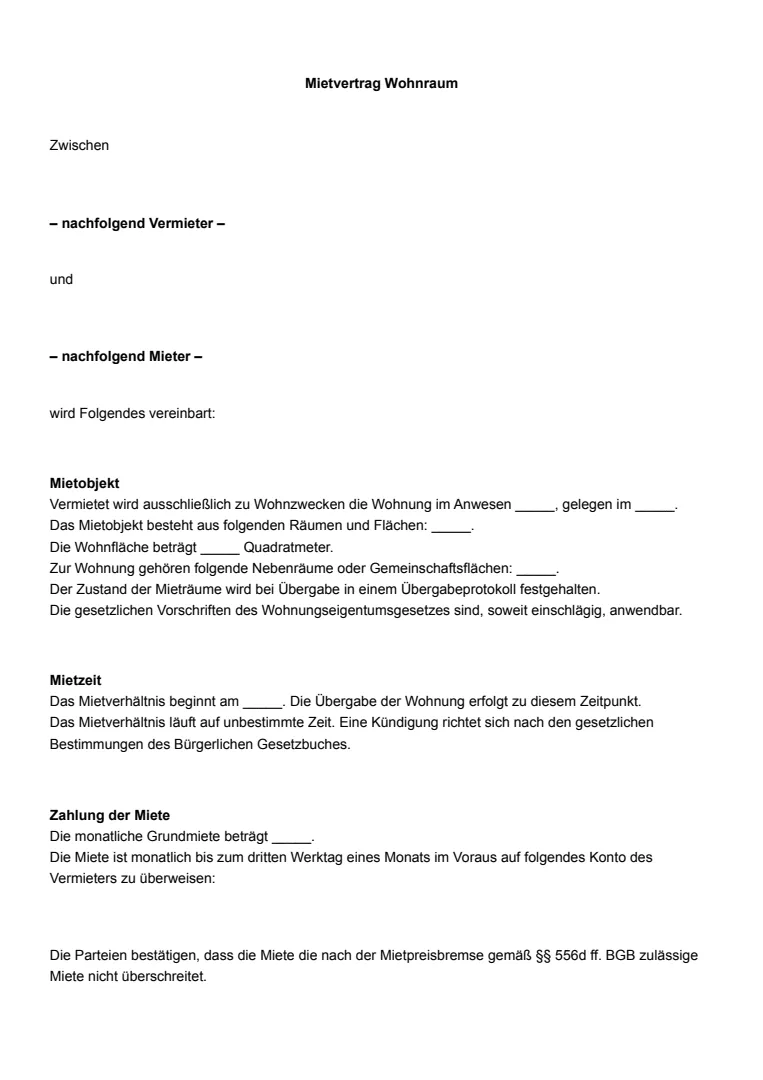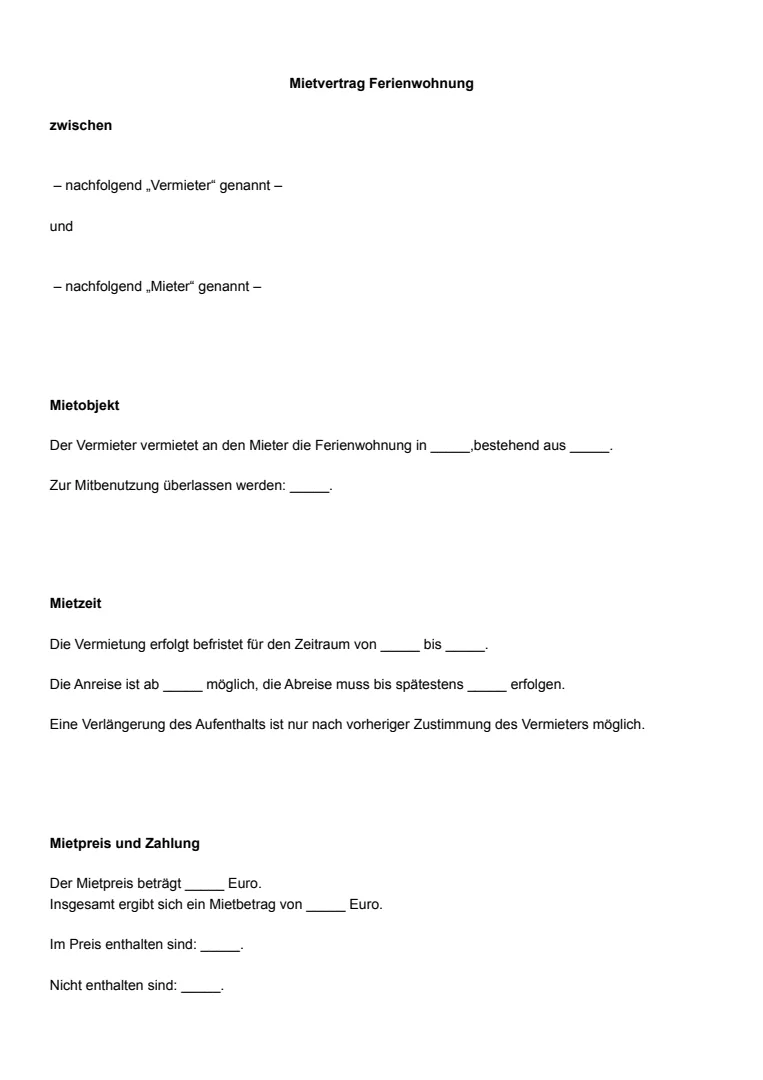Was ist ein Untermietvertrag
Ein Untermietvertrag ist ein eigenständiger Vertrag zwischen dir als Hauptmieter:in und einer weiteren Person, die einen Teil oder die gesamte Wohnung nutzen möchte. Er gilt zusätzlich zum Hauptmietvertrag mit der Vermieterin und darf dessen Rechte und Pflichten nicht verletzen.
Rechtlich geregelt wird die Untervermietung vor allem durch das Bürgerliche Gesetzbuch, insbesondere die §§ 540 und 553 BGB. Diese Bestimmungen schützen die Interessen des Vermieters, geben dir aber auch einen Anspruch auf Zustimmung, wenn ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung vorliegt.
Expertentipp:
Kläre früh, ob ein berechtigtes Interesse nach § 553 BGB vorliegt, und hole die Zustimmung der Vermieterin schriftlich ein. Verweise im Vertrag auf das Zustimmungsdatum.
Wann braucht man einen Untermietvertrag
1. Vorübergehende Abwesenheit
Wenn du deine Wohnung aufgrund einer längeren Reise, eines beruflichen Projekts oder eines Auslandssemesters nicht selbst nutzen kannst, ist die Untervermietung oft die beste Lösung. Sie ermöglicht es dir, die laufenden Mietkosten zu decken und gleichzeitig die Wohnung zu behalten. Ein Untermietvertrag schafft hier Sicherheit, indem er die Dauer klar definiert, die Höhe der Miete regelt und Rechte sowie Pflichten des Untermieters festhält. Besonders wichtig ist die Zustimmung des Hauptvermieters (§ 540 BGB), da eine unerlaubte Gebrauchsüberlassung sogar zur Kündigung führen kann.
2. Wohngemeinschaften
In Wohngemeinschaften ist der Untermietvertrag ein unverzichtbares Instrument, um das Zusammenleben rechtlich und organisatorisch abzusichern. Er legt nicht nur die Mietzahlung fest, sondern auch, wie Nebenkosten wie Strom oder Internet verteilt werden und welche Regeln für die Nutzung von Gemeinschaftsräumen wie Küche oder Bad gelten. Gerade wenn Mitbewohner nur für einen begrenzten Zeitraum bleiben, sorgt der Vertrag für Transparenz und verhindert Konflikte über Kündigungsfristen oder Absprachen im Alltag. Wer hier auf eine präzise Formulierung achtet, beugt vielen typischen WG-Streitigkeiten vor.
3. Zwischenmiete mit Befristung
Die befristete Zwischenmiete ist vor allem bei Studierenden und Berufstätigen beliebt, die für einige Monate ihre Wohnung nicht selbst bewohnen können. Ein befristeter Untermietvertrag gibt beiden Seiten Sicherheit, da von Anfang an klar ist, wann das Mietverhältnis endet. Damit vermeidest du komplizierte Kündigungsprozesse oder rechtliche Auseinandersetzungen. Zudem sollte im Vertrag ausdrücklich festgehalten werden, ob und unter welchen Umständen eine Verlängerung möglich ist. Ein solcher Rahmen bietet Planbarkeit für dich und den Untermieter und verhindert Missverständnisse über Rückzugstermine.
4. Vermietung möblierter Zimmer
Wenn du ein möbliertes Zimmer untervermietest, ist eine genaue Dokumentation der Ausstattung entscheidend. Der Vertrag sollte eine Inventarliste enthalten, die Möbel, Elektrogeräte und deren Zustand im Detail beschreibt. Auf diese Weise kannst du bei Auszug nachweisen, ob Gegenstände beschädigt wurden, und gegebenenfalls Ansprüche aus der Kaution ableiten. Zusätzlich lassen sich im Vertrag Regelungen zur Nutzung festlegen, etwa, ob bestimmte Möbel umgestellt werden dürfen oder wie Geräte wie Waschmaschinen oder Fernseher zu handhaben sind. So schützt du dein Eigentum und stellst gleichzeitig faire Bedingungen für den Untermieter sicher.
Wie erstellt man einen Untermietvertrag
1. Daten und Identität
Ein vollständiger Untermietvertrag beginnt immer mit den Angaben der beteiligten Parteien. Dazu gehören die vollständigen Namen, aktuelle Anschriften und Kontaktdaten von Haupt- und Untermieter. Zusätzlich sollte die genaue Bezeichnung des Mietobjekts enthalten sein – also Adresse, Stockwerk, Wohnungsnummer oder Zimmernummer. Je präziser die Angaben sind, desto geringer ist das Risiko von Streitigkeiten darüber, was tatsächlich vermietet wurde. Bei größeren Wohnungen kann es sinnvoll sein, Grundrisse oder Lagepläne beizufügen, um Missverständnisse zu vermeiden.
2. Höhe der Miete
Die Mietzahlung ist das Herzstück eines Untermietvertrags und muss eindeutig geregelt sein. Neben der Höhe der monatlichen Miete solltest du auch den Fälligkeitstermin, die Zahlungsweise (z. B. Überweisung auf ein bestimmtes Konto) und mögliche Zuschläge wie für Möblierung festhalten. Achte darauf, die Miete transparent zu gestalten und im Verhältnis zur Hauptmiete zu halten, um rechtliche Probleme wegen überhöhter Forderungen zu vermeiden (§ 5 WiStG). Für Untermieter bietet eine klare Regelung Sicherheit, während du als Hauptmieter deine Ansprüche im Konfliktfall besser durchsetzen kannst.
Expertentipp:
Lege die Untermiete im Verhältnis zur Hauptmiete offen und dokumentiere etwaige Möblierungszuschläge separat, um Risiken nach § 5 WiStG zu reduzieren. Fälligkeit, Konto und Verzugsfolgen klar benennen.
3. Nebenkostenregelung
Bei Nebenkosten gibt es unterschiedliche Modelle: Pauschalen bieten Planungssicherheit, während Abrechnungen nach tatsächlichem Verbrauch eine faire Verteilung ermöglichen. In Wohngemeinschaften wird häufig nach Zimmergröße oder gleichmäßig pro Kopf abgerechnet. Wichtig ist, dass die gewählte Methode eindeutig im Vertrag vermerkt wird, um spätere Diskussionen zu vermeiden. Gerade bei hohen Energiepreisen lohnt es sich, klare Vereinbarungen zu treffen, etwa, ob Nachzahlungen möglich sind oder ob die Pauschale alle Kosten vollständig abdeckt. Transparenz schützt hier beide Seiten vor finanziellen Überraschungen.
Expertentipp:
Entscheide dich bewusst zwischen Pauschale und Abrechnung. Bei Pauschalen Nachzahlungslogik definieren, bei Abrechnung Belegeinsicht und Umlageschlüssel festhalten. Energiepauschalen regelmäßig prüfen.
4. Laufzeit und Kündigung
Die Laufzeit des Untermietvertrags beeinflusst maßgeblich die Planungssicherheit für Haupt- und Untermieter. Ein befristeter Vertrag endet automatisch zum vereinbarten Datum, wodurch du als Hauptmieter sicherstellen kannst, dass du die Wohnung zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder vollständig nutzen kannst. Unbefristete Verträge hingegen erfordern eine Kündigung, bei der die gesetzlichen Fristen nach § 573c BGB einzuhalten sind. Sinnvoll ist es, die Kündigungsmodalitäten detailliert im Vertrag zu regeln, etwa ob eine Kündigung schriftlich erfolgen muss und ob besondere Umstände eine verkürzte Frist rechtfertigen.
5. Inventar und Ausstattung
Wenn du ein möbliertes Zimmer oder eine teilweise eingerichtete Wohnung untervermietest, ist eine Inventarliste unerlässlich. Dort werden alle Möbelstücke, Elektrogeräte und sonstige Einrichtungsgegenstände aufgeführt, inklusive einer Beschreibung des Zustands bei Übergabe. Auf diese Weise können Schäden eindeutig festgestellt und Ansprüche aus der Kaution gerechtfertigt werden. Es empfiehlt sich außerdem, Fotos anzufertigen und diese gemeinsam mit der Liste als Anhang zum Vertrag zu nehmen. So stellst du sicher, dass es bei Rückgabe keine Diskussionen über fehlende oder beschädigte Gegenstände gibt.
Expertentipp:
Führe eine Inventarliste mit Zustandsbeschreibung, ergänze datierte Fotos und lass jede Seite mit Kürzel unterschreiben. Kautionszweck und Rückzahlungsbedingungen konkretisieren.
Welche Inhalte gehören in einen Untermietvertrag
Ein vollständiger Untermietvertrag enthält mehrere Kernbestandteile:
- Parteien des Vertrags: Haupt- und Untermieter mit Kontaktdaten
- Beschreibung des Mietobjekts: Größe, Lage, Ausstattung
- Mietzins und Nebenkosten: Höhe, Zahlungsart, Abrechnungsmodus
- Kaution: Höhe und Rückzahlungsbedingungen
- Laufzeit und Kündigung: Befristet oder unbefristet, Fristen
- Rechte und Pflichten: Nutzung gemeinsamer Räume, Hausordnung
- Inventarliste: Gilt besonders bei möblierten Zimmern
- Unterschriften: Rechtswirksam wird der Vertrag erst mit beiderseitiger Unterzeichnung
Praktische Tipps für einen Untermietvertrag
- Schriftform einhalten: Mündliche Vereinbarungen sind zwar gültig, aber schwer nachweisbar. Eine schriftliche Fassung schafft Klarheit.
- Zustimmung des Vermieters einholen: Ohne diese riskierst du Abmahnung oder sogar Kündigung des Hauptmietvertrags (§ 540 BGB).
- Nebenkosten realistisch ansetzen: Zu knapp kalkulierte Pauschalen können später zu Konflikten führen, wenn die Kosten nicht gedeckt sind.
- Kaution vereinbaren: Üblich sind ein bis drei Monatsmieten. Damit sicherst du dich gegen Schäden oder Mietrückstände ab.
- Übergabeprotokoll nutzen: Dokumentiere beim Ein- und Auszug den Zustand des Zimmers. Das vermeidet spätere Diskussionen über Schäden.
Wichtige Erkenntnisse
Ein Untermietvertrag ist ein wirksames Mittel, um deine Interessen als Hauptmieter:in zu schützen und gleichzeitig faire Bedingungen für den Untermieter zu schaffen. Er bietet Klarheit über Mietpreis, Nebenkosten und Rechte und verhindert spätere Streitigkeiten.
Wer eine strukturierte Vorlage nutzt und die wichtigsten rechtlichen Anforderungen beachtet, sorgt für Transparenz und Sicherheit für beide Seiten.